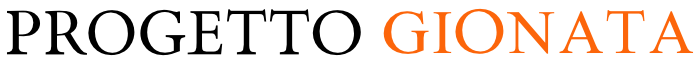Von Sodom zur Sodomie und zur Homosexualität – oder: Wie Andersheit hergestellt wird
Gleichgeschlechtliches sexuelles Verhalten gab es immer und in allen Kulturen; Homosexualität aber, d.h. die Vorstellung einer festen Disposition, ist eine westliche Sichtweise, die noch gar nicht so alt ist. Und sie hat ihre Wurzeln in der christlichen Theologie.
In anderen Kulturen wird gleichgeschlechtliches Verhalten ganz anders verstanden. Es wird meist nicht einer bestimmten Gruppe von Menschen zugeordnet, sondern gilt vielerorts als eine Aktivität, die allen möglich ist, allen Männern und Frauen.
Ein interessantes Beispiel ist wahrscheinlich der biblische König David. Von ihm werden wechselnde Liebesgeschichten erzählt, mit Männern und mit Frauen. Schwule Theologen haben immer wieder einmal den Versuch gemacht, uns David als „schwul“ zu präsentieren, während konservative Bibelwissenschaftler sich dann bemühten zu beweisen, dass David natürlich „heterosexuell“ gewesen sei. Natürlich ist beides Unsinn.
Wenn wir hier überhaupt etwas über David sagen können, dann müssen wir uns klar machen, dass in der damaligen Welt die Kulturmuster „Heterosexualität“ und „Homosexualität“ unbekannt waren. David kannte diese Kategorien nicht; er empfand nicht gemäß diesen Kategorien und lebte deshalb auch nicht gemäß den Grenzen dieser Kategorien. Für ihn waren sicher ganz andere Leitlinien bestimmend.
Wie kam es aber dann dazu, dass ganz offenbar in Anlehnung an die biblische Erzählung von der Zerstörung der Stadt Sodom irgendwann der Ausdruck „Sodomie“ entstand und später das Konzept der „Homosexualität“? Lassen Sie mich in einem schnellen Lauf durch die Jahrtausende ein paar Stationen dieser Entwicklung beleuchten!
In der biblischen Erzählung über Sodom hat Lot zwei durchreisende männliche Engel in seinem Haus als Gäste aufgenommen. Nach dem Abendessen, so wird erzählt, haben sich vor Lots Haus sämtliche Männer Sodoms, alte wie junge, versammelt und verlangen, als sei das nicht Besonderes, die Herausgabe der Engel, um mit ihnen zu verkehren.
Gewaltandrohung liegt in der Luft, Lot wird schwer zugesetzt; er bietet dem wildgewordenen Mob statt der Engel seine beiden noch jungfräulichen Töchter zur Vergewaltigung an. Es kommt aber weder zur Vergewaltigung der Engel noch zur Vergewaltigung der Töchter. Lot verlässt mit Frau und Töchtern die Stadt und die Engel veranlassen die Vernichtung Sodoms und fünf weiterer Städte durch Gott.
Soweit die Geschichte. Es liegt auf der Hand, dass sich aus dieser Erzählung kaum eine Ethik zur Beurteilung sexueller Aktivitäten ableiten lässt. Ging es in der Geschichte überhaupt darum, dass die Engel männlich waren? Ist es moralisch, seine Töchter zur Vergewaltigung anzubieten? Hätte Lot das mit Söhnen ebenso gemacht?
Geht es eher um das antike Gebot, die Fremden zu schützen, und sei es unter Aufbietung der eigenen Kinder? Merkwürdig ist auch, dass es in dieser Geschichte letztlich zu keinem Gewaltakt kommt – aber dennoch wird Sodom zerstört! Warum? Wird die Stadt für etwas bestraft, das sie nicht getan hat? Oder ist mit der „Sünde Sodoms“ doch etwas anderes gemeint?
Dass in dieser Geschichte, wie es der Katechismus der Katholischen Kirche formuliert, „Homosexualität“ als „schlimme Abirrung“ bezeichnet werde (Nr. 2357), ist gewiss Unsinn. Davon ist an keiner Stelle die Rede. Interessanter ist, welchen Reim sich die Menschen bereits in biblischen Zeiten auf diese Geschichte gemacht haben. Denn die Sodom-Erzählung fand in zahlreichen anderen biblischen Schriften ein Echo.
Im Alten Testament, also in den jüdischen Reaktionen auf diese Geschichte, kommen mögliche sexuelle Aspekte überhaupt nicht in den Blick. Bei den Propheten Jesaja (3,9) und Jeremia (23,14) wird die Sünde in der Arroganz der Bewohner Sodoms gesehen, für den Propheten des Ezechielbuchs (16,49f) bestand ihre Bosheit in der Weigerung, den Armen beizustehen.
Sexuelle Aspekte der Erzählung werden erst an zwei Stellen im Neuen Testament angedeutet (2 Petr 2,10; Jud 7–8). Dort ist etwa von der „schmutzigen Begierde des Körpers“ die Rede. Dass die Autoren dieser spätneutestamentlichen Schriften aus der Sodom-Erzählung allerdings eine Verurteilung gleichgeschlechtlicher Sexualität herausgelesen hätten, ist beim besten Willen nicht zu erkennen.
Unter kirchlichen und kanonischen Autoren lässt sich aber dann allmählich ein wachsendes Interesse an den sexuellen Aspekten dieser Geschichte erkennen, etwa bei Ambrosius im 4. Jahrhundert und bei Augustinus im 5. Jahrhundert, wobei man gerechterweise gleich hinzufügen muss, dass Augustinus sich dabei eher für das Problem „ungeordneter Begierden“ interessiert als für gleichgeschlechtliche Handlungen.
Erst um das 7. Jahrhundert legt sich Gregor der Große († 604) auf eine eindeutig sexuelle Auslegung der Sodom-Geschichte fest: Sodom ist für ihn der Inbegriff für die Strafe Gottes wegen „Verbrechen des Fleisches“ (scelera carnis). Was aber wiederum diese „Verbrechen des Fleisches“ sein sollten, stand für die christlichen Theologen noch lange nicht fest. Reichsbischof Burkhard von Worms dachte im 11.
Jahrhundert speziell an den Analverkehr zweier Männer, wenn er von der Sünde sprach, „wie die Sodomiter es tun“. Zugleich wäre es ihm aber nie eingefallen, etwa die Masturbation zweier Männer „sodomitisch“ zu nennen. Die kam in seinem Bußbuch zwar auch vor, wurde aber nicht mit Sodom in Verbindung gebracht.
Andere Autoren wiederum bezeichneten ganz andere Handlungen als „sodomitisch“. In vielen Fällen war das ein allgemeiner Ausdruck für Formen sexuellen Verkehrs, die als „widernatürlich“ angesehen wurden. Selbst sexuelle Akte zwischen Mann und Frau wurden gelegentlich als „sodomitisch“ bezeichnet, wenn sie nicht auf Fortpflanzung ausgerichtet waren.
Man muss also sehr genau hinsehen, wenn man alte theologische Texte durchforstet – nicht immer sind gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen gemeint, wenn von „sodomitisch“ die Rede ist. Einfache Identifizierungen sind nicht zulässig.
Zu einem wirklichen Wendepunkt der Geschichte kommt es aber, als Petrus Damiani im 11. Jahrhundert die Szene betritt. Damiani ist der Wortführer der Gregorianischen Reform, ein glühender Verfechter des Priesterzölibats und ein wütender Kämpfer gegen das „sodomitische Laster“.
Was ihn so wütend macht, ist sein Eindruck, dass dieses Laster immer mehr Verbreitung findet in den Orden, unter den Priestern und in der Gesellschaft, dass sich aber außer ihm offenbar kaum jemand sehr daran stört. Deshalb schreibt er einen langen Brief an Papst Leo IX. Es ist eine Art Denkschrift mit dem Titel „Liber Gomorrhianus“ (1049).
Petrus Damiani tritt darin dafür ein, das sodomitische Laster wesentlich strenger zu bestrafen, als dies bis dahin die kirchlichen Bußbücher vorgesehen hatten. Seine Vorschläge reichen von der Amtsenthebung sodomitischer Priester bis hin zur Todesstrafe.
Zu seinen Lebzeiten hatte Damiani damit keinen Erfolg. Erst gut 130 Jahre später, auf dem 3. Laterankonzil (1179), werden einige seiner Forderungen aufgegriffen. Damit haben wir übrigens im 12. Jahrhundert die erste Stellungnahme eines Konzils von gesamtkirchlicher Bedeutung. (Bis dahin gab es bestenfalls sporadische Äußerungen von Regionalsynoden).
In seinem Brief an Papst Leo schenkt Damiani der Welt nun eine neue Vokabel: die Sodomie. Bis dahin sprach man von der „Sünde Sodoms“, vom „sodomitischen Laster“, vom „Tun, wie die Sodomiter tun“.
Und mit Sodomitern meinte bis dahin man die Einwohner Sodoms – nicht mehr.
Nun aber prägte Damiani den Ausdruck „Sodomie“. Er tat dies in bewusster Analogie zur Blasphemie – der Gotteslästerung. „Wenn Blasphemie die schlimmste Sünde ist“, schrieb er, „weiß ich nicht, auf welche Weise Sodomie besser sein sollte.“ Das Wort „Sodomie“ ist also von Anfang an kein neutraler Ausdruck, der nur eine Sache benennen will, sondern die Qualifizierung einer schweren Sünde. Für Damiani war hinfort „Sodomie“ der Oberbegriff für alle Arten von sexuellen Handlungen zwischen Männern.
Damit kam aber eine neue Qualität ins Spiel: Sodomiter sind damit nicht mehr die Bewohner des Städtchens Sodom am Toten Meer, und auch nicht jene, die tun, was man den Einwohnern von Sodom unterstellt hat. Sodomiter sind jetzt vielmehr die Träger des Merkmals „Sodomie“. Das bedeutet, Sodomiter sind nicht mehr Personen, die aus den unterschiedlichsten Motiven und in den unterschiedlichsten Umständen Handlungen ausführen, die eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen. Sodomiter sind vielmehr Leute, die Sodomie begehen.
So entsteht aus mehr oder weniger klar umrissenen Handlungen ein bestimmter Menschentypus, eine andere Art. Was für ein Wechsel der Betrachtungsweise darin liegt, können Sie sich an einem Analogieschluss deutlich machen: Stellen Sie sich vor, Diebe würden künftig nicht mehr Diebe genannt, sondern allesamt Kleptomanen.
Mit einmal Mal wären das nicht mehr Menschen, die etwas Falsches getan haben und sich ändern können, sondern es wäre eine Gruppe mit einer bestimmten Disposition, Menschen, die nicht anders können, bedauernswerte, pathologische Geschöpfe. Auf jeden Fall wären diese Kleptomanen ganz anders als wir, hätten also nichts mit uns zu tun, und weil es sich um eine andere Sorte Menschen handelte, läge in ihrem Verhalten auch keine Anfrage, ob wir denn immer ehrlich sind.
So ähnlich verhält es sich mit der „Sodomie“. Man macht aus einer Gruppe von Menschen eine eigene Art, die man von den „normalen“ Menschen dann klar abgrenzen kann. Und alles das, was man an sich selbst lieber nicht wahrhaben möchte – schließlich leben ja alle Menschen gelegentlich in einer „Verwirrung der Gefühle“, projiziert man auf die Gruppe der „Anderen“, der Sodomiter. Und weil diese „Anderen“ eben anders sind – eine andere Art, eine andere Rasse –, traut man ihnen im Laufe der Zeit auch alles Mögliche zu.
Im 13. Jahrhundert verwendet z.B. Paul von Ungarn schon durchgehend die Bezeichnung „Sodomie“ – und für ihn ist völlig klar, dass diese Anderen, diese Sodomiter, auch für Hungersnöte, Pest und Erdbeben verantwortlich sind. Und in dieser Eigenschaft als „Andere“ gehören die Sodomiter im ausgehenden Mittelalter dann mit den Hexen und den Juden zu jener Trias der andersartigen Feinde der Christenheit. Und sie werden mehr und mehr mit diabolischen Merkmalen gezeichnet.
Natürlich geschieht dies alles nicht in einem rein ideologischen Raum. Der gesellschaftliche Hintergrund sind die sozialen Umwälzungen, die im 13. Jahrhundert vehement einsetzen: Städte entstehen, Menschen verlassen ihre Familienverbände, um in der Stadt ihr Glück zu suchen, neue Wirtschaftsformen bilden sich heraus, viele Menschen verelenden – und große Unsicherheit greift um sich. Die Familien scheinen keine Sicherheit mehr bieten zu können; die Theologie reagiert mit einer wahren Flut von Literatur zum Lob der Ehe – und mit der Sakramentalisierung der Ehe auf dem zweiten Konzil von Lyon 1274. Zur gleichen Zeit werden in Siena, Bologna, Florenz und Perugia erstmals „Sodomiter“ geblendet, kastriert oder auf den Scheiterhaufen gebracht.
Dennoch sollte man nicht dem Fehlschluss erliegen, dass „die Kirche“ seither einheitlich gehandelt habe. Es gab immer wieder Zeiten, in denen „Sodomie“ kein Thema war. Es gab Päpste und Theologen, die sich nicht dafür interessierten. So argumentierte etwa Thomas von Aquin zwar auf der Linie der kirchlichen Lehre und ordnete die „Sodomie“ der Todsünde der Wollust zu, aber er widmete der ganzen Sache in seinem umfangreichen Werk kaum mehr als fünf Zeilen.
Was uns allerdings aus dem Mittelalter bleibt, ist der Gedanke, dass die Praxis der „Sodomie“ einen Menschen zum „Sodomiter“ macht, zu einer anderen Spezies. Und das ist tatsächlich ein Produkt der christlichen Theologie. Ohne diese Vorstellung wäre es im ausgehenden 19. Jahrhundert wahrscheinlich nicht zu einer so umgehenden Akzeptanz des ähnlich gelagerten, aber weiterreichenden Konzepts der „Homosexualität“ gekommen.
„Homosexualität“ ist nicht einfach eine neuzeitliche Entsprechung zur mittelalterlichen Sodomie. Der österreichische Schriftsteller Karl Maria Benkert, der den Begriff im Jahr 1869 prägte, verband damit durchaus emanzipatorische Hoffnungen.
Indem er den theologischen Begriff durch einen medizinisch-naturwissenschaftlich klingenden Ausdruck ersetzte, hoffte er, die Sache damit der moraltheologischen Beurteilung zu entziehen. „Homosexualität“ sei eine Veranlagung, eine naturgegebene Sache, argumentierte Benkert. Die Betroffenen könnten nichts dafür. Und schon deshalb könne „Homosexualität“ keine Sünde sein. Benkert dachte und argumentierte ganz gemäß dem Zeitgeist des 18. und 19. Jahrhunderts: Damals war es Mode, für alle Unterschiede unter den Menschen und für jede Verhaltensauffälligkeit eine biologische Ursache auszumachen.
Das tat man mit Frauen, Juden und Schwarzen genauso. Und indem man ihre Eigenart biologisch festgestellt hatte, war damit zugleich entschieden, dass es aus demselben Grund niemals eine Gleichheit, geschweige denn eine Gleichberechtigung all dieser Gruppen geben könne. Man hielt das damals für den letzten Schrei des naturwissenschaftlichen Denkens – heute erscheint es uns eher als ein rassistischer Irrweg des 19. Jahrhunderts.
Trotzdem hat der Begriff „Homosexualität“ große Karriere gemacht; er gilt bis heute als die einzig seriöse Bezeichnung des Phänomens der gleichgeschlechtlichen Sexualität. Dadurch überlebt aber gerade die problematischste „Errungenschaft“ der mittelalterlichen Theologie: Die wesenhafte Andersheit der Sodomiter überlebt in der biologisch-psychologischen Andersheit der Homosexuellen.
Wir leben heute zwar in einem sehr liberalen gesellschaftlichen Klima, aber die Vorstellung, dass Homosexuelle irgendwie anders sind – sei es veranlagungsbedingt durch Hormone oder Gene oder entwicklungsbedingt durch psychische Abnormitäten – ist fest im Denken der meisten Menschen im Westen verankert. Diese festgeschriebene Andersheit konserviert eine Trennlinie, die umgehend wieder „scharf“ gemacht werden kann, wenn sich das gesellschaftliche Klima ändern sollte.
Deshalb meine ich, dass das liberale Anerkennen der Andersheit von Schwulen und Lesben nicht weit genug über Petrus Damiani hinausführt. Wünschenswert wäre stattdessen die Einsicht, wie künstlich und willkürlich die Unterscheidungen zwischen „Homosexualität“ und „Heterosexualität“ sind.
Wir wissen spätestens seit Freud, dass jeder Mensch auch gleichgeschlechtliche Gefühle hat – auch wenn nicht unbedingt all diese Gefühle wahrgenommen und gelebt werden. Wenn aber Menschen, die ansonsten „ganz normal heterosexuell“ leben, gelegentlich solche Gefühle bei sich entdecken, kann das Angst und Panik auslösen: die Panik nämlich, doch zu dieser „anderen Art“ zu gehören, der unsere Kultur solche Gefühle zuordnet.
Und diese Panik äußert sich dann in demonstrativen Distanzierungsgesten – „Ich bin doch keiner von denen!“ –, heftigen antischwulen und antilesbischen Tiraden und oft genug auch in handgreiflicher Gewalt gegen Lesben und Schwule, also gegen diejenigen, die sich gestatten, genau diese Gefühle zu leben, die wahrscheinlich die meisten Menschen bis zu einem gewissen Grade in sich spüren.
Sie sehen: Ich sehe die Wurzeln von Homophobie und homophober Gewalt in der Herstellung von Andersheit durch die Begriffe der Sodomie und der Homosexualität. Deshalb wäre es wichtig, dass wir diese Hetero-Homo-Dichotomie allmählich loswerden, indem wir lernen, mit allen unseren Gefühlen zu leben und nicht einen Teil davon als etwas Fremdes abzuspalten.
Das geht sicher nicht von heute auf morgen, aber ich hoffe doch, dass wir das vergiftete Erbe Petrus Damianis irgendwann endlich überwinden.
Italian translation
Da Sodoma alla sodomia all’omosessualità, come si crea la diversità